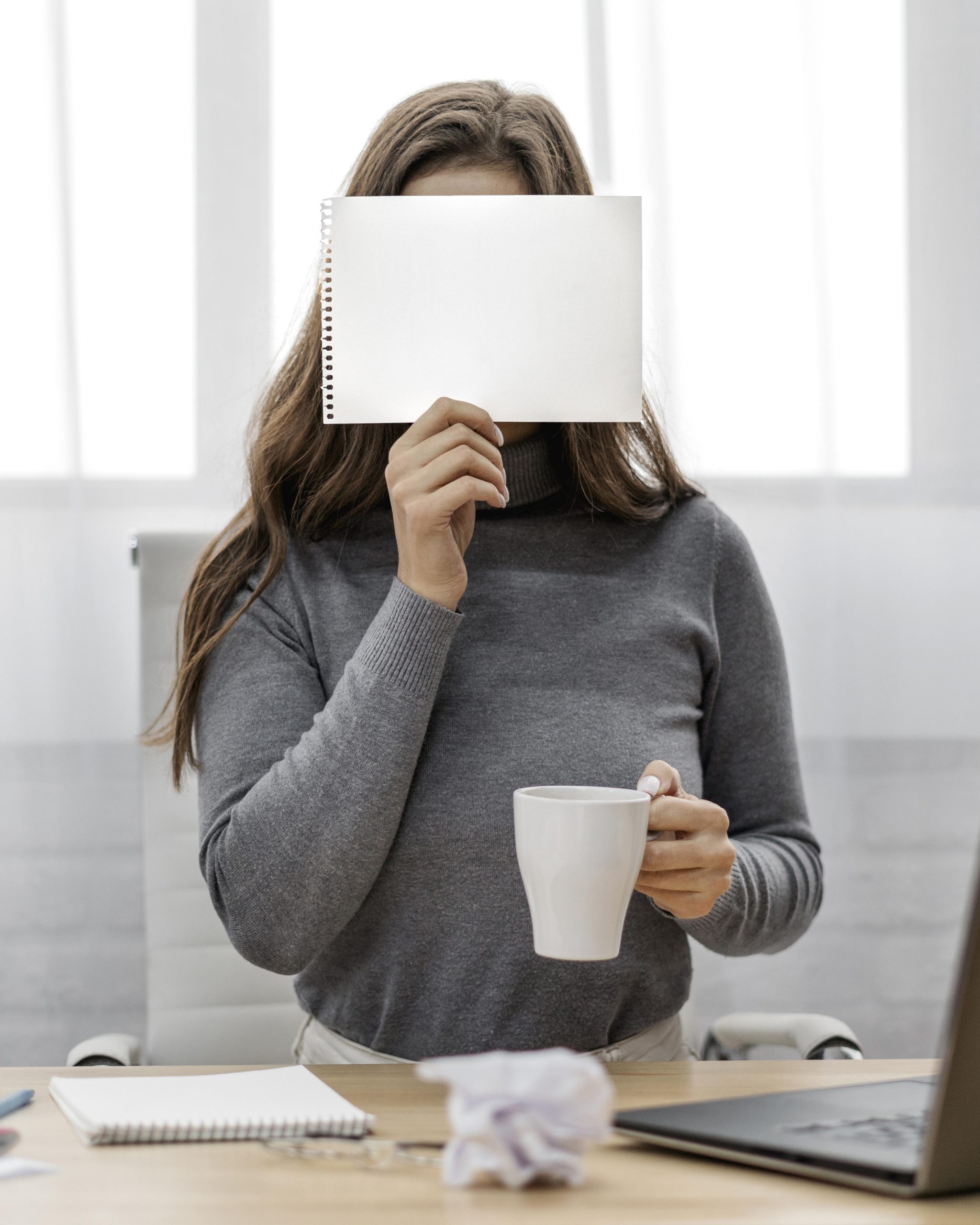Taskmasking: Du wirkst beschäftigt – aber bist du es auch?
Während Digitalisierung, künstliche Intelligenz und ortsunabhängiges Arbeiten zu den grössten Schlagworten zählen, wirkt die Forderung nach braver Büropräsenz fast wie ein Anachronismus. Doch genau diese Rückkehr an den Schreibtisch wird vielerorts wieder verlangt – mit der unausgesprochenen Erwartung: Wer sichtbar ist, arbeitet auch. Ist das so?
Diese Gleichsetzung von Anwesenheit und Produktivität war schon vor der Pandemie fragwürdig, heute wirkt sie wie aus der Zeit gefallen. Und genau hier beginnt der stille Aufstand und der versteckte rebellische Widerstand gegen diesen alten Zopf.
Während Unternehmen euphemistisch von ‘Teamgeist’ und ‘Kollaboration’ schwurbeln, erleben viele Angestellte die neue Präsenzpflicht als klarer Rückschritt, als aufgeladenes Symbol mangelnden Vertrauens.
Die Antwort darauf ist keine offene, empörte oder resignierte Konfrontation – sondern stille Subversion in sublimer Form: Menschen tun einfach das, was das ‘fucking System’ verlangt – sie erscheinen. Aber sie leisten nicht.
Sie perfektionieren die Kunst des sogenannten Taskmaskings – eine Art digitale Camouflage, mit der sie im System bleiben, ohne sich ihm zu unterwerfen. Es ist ein leiser Protest, fast unsichtbar, aber in seiner Wirkung tiefgreifend: Die Arbeitswelt wird zum Theater, und jeder spielt eine Rolle – bis der Vorhang fällt.
Die neue Rolle: Hauptdarsteller:in im Theater des modernen Bürolebens
Taskmasking ist nicht einfach ein Trick der Faulen, sondern eine äusserst raffinierte Anpassungsstrategie an eine dysfunktionale Arbeitskultur. Die Inszenierung beginnt am Morgen: Der Weg ins Büro mit Laptop in der Hand, vielleicht ein Cappuccino in der anderen. Im Grossraumbüro angekommen, Kopfhörer rein – ‘Ich bin beschäftigt’ und gleichgültige Miene.
Der Bildschirm ist geöffnet, E-Mails sind sichtbar, vielleicht läuft sogar ein nettes Gespräch remote via Bildschirm im Hintergrund. Doch wer genau hinschaut, sieht: Viel passiert nicht. Oder zumindest nicht das, was das Unternehmen glaubt.
Das Paradoxe: Diese Show ist nicht nur akzeptiert, sondern oft auch erwünscht. Führungskräfte fühlen sich wohler, wenn sie ihre Leute ‘sehen’. Die Mitarbeitenden wiederum fühlen sich weniger kontrolliert, wenn sie die Regeln des Spiels diszipliniert beherrschen. Es entsteht ein stillschweigendes Übereinkommen – ein kollektives Schauspiel, das alle mittragen.
Die Leistung tritt in den Hintergrund, die sichtbare Performance wird zum Massstab. In diesem Sinn ist Taskmasking keine Täuschung – es ist Anpassung an eine Realität, die sich allerdings immer weiter von ihrem ursprünglichen Zweck entfernt hat.
Die wahren Fachkräfte des Taskmaskings: Vom Bauarbeiter bis zur Backoffice-Fachkraft
Man könnte meinen, Taskmasking sei ein exklusives Phänomen der Kopf- und Wissensarbeiter. Doch weit gefehlt: Auch im ‘Blue-Collar-Bereich’ gibt es Formen der gespielten Geschäftigkeit, die mehr Fassade als Substanz sind. Wer schon einmal erlebt hat, wie ein halber Bautrupp stundenlang auf die Lieferung eines Teils wartet – ohne dass irgendjemand dies offen zugibt –, weiss: Auch dort wird gekonnt ‘maskiert’. Und zwar mit Zigarette in der Hand, Blick aufs Handy und dem Satz: ’Wir klären gerade was mit dem Vorarbeiter.’
Im Büro hingegen sind die Werkzeuge andere. Taskmasking bedient sich digitaler Requisiten: geöffnete Kalender, Fake-Meetings, getarnte Privat-Chats in Teams, scheinbar produktive Geräusche wie das rhythmische Klackern der Tastatur. Wer sich besonders geschickt anstellt, synchronisiert sogar mehrere Devices, um parallel als ‘busy’ zu erscheinen.
Die besten Taskmasker schaffen es, acht Stunden im Büro zu verbringen, dabei kaum substanziell zu arbeiten – und trotzdem als engagiert und belastbar zu gelten. In einem System, das Präsenz über Resultate stellt, ist das keine Schwäche – sondern Effizienz durch geschickte Anpassung.
Kontrollwahn trifft auf Selbstwirksamkeit – und scheitert
Seit der Rückkehr ins Büro investieren Unternehmen erstaunlich massiv in Kontrollinstrumente: digitale Stempeluhren, Aktivitäts-Tracking, künstliche Intelligenz zur Erfassung von Produktivität. Druck erzeugt jedoch Gegendruck. Je dichter das Netz der Überwachung ausgestaltet ist, desto geschickter werden die Ausweichstrategien. Kontrolle provoziert Konformität – aber niemals Kreativität.
Und genau darin liegt das Problem: Wer Menschen behandelt wie Maschinen, bekommt Maschinenverhalten. Genormt. Automatisiert. Uninspiriert.
Dabei zeigt die Forschung klar: Menschen arbeiten dann produktiv, wenn sie sich als wirksam erleben – wenn sie sehen, dass ihr Tun einen Unterschied macht. Doch die ständige Überwachung raubt dieses Gefühl. Wer jeden Mausklick rechtfertigen muss, verliert die Motivation, wirklich etwas zu bewirken. Das Resultat: Man beginnt zu spielen. Nicht mehr mit Ideen, sondern mit dem System selbst. Die Arbeitszeit wird zur Bühne. Die Arbeit zum Hintergrundrauschen.
Arbeit und Leben – entgrenzt, verschmolzen, verwässert
Das moderne Arbeitsbiotop hat die strikte Trennung von Beruf und Privatleben längst aufgehoben. Dank Smartphones, Laptops und 5G sind wir überall sofort erreichbar – jederzeit. Der Frühstückstisch wird zum Mini-Büro, das Feierabendbier zur kurzen Projektbesprechung und die Zigarettenpause hilft die nächsten Schritte am Telefon zu planen. Diese ständige Vermischung hat jedoch auch eine Gegenreaktion ausgelöst: Wenn das Private ins Berufliche dringt, dann dringt das Private auch ins Büro. Taskmasking ist genau diese Umkehr: persönliche Interessen, Aktivitäten und Pausen getarnt als ‘busy time’.
Und seien wir ehrlich: Wer glaubt, dass Mitarbeitende von 9 bis 18 Uhr durchgehend konzentriert und mit voller Motivation arbeiten, lebt in einer naiven Illusion. Die menschliche Aufmerksamkeit funktioniert zyklisch. Konzentration ist endlich. Pausen sind notwendig. Das Problem ist nicht, dass Menschen im Büro zwischendurch abschalten. Das Problem ist, dass sie so tun müssen, als täten sie es nicht. Das ist der eigentliche Energieverlust.
Die produktive Pause – ein Tabu, das wir endlich brechen müssen
Was wäre, wenn wir Taskmasking nicht als Problem, sondern als Symptom der Moderne verstehen würden? Als Indikator dafür, dass das System falsche Anreize setzt? Die Wissenschaft ist klar: Menschen, die regelmässig echte, bewusst genommene Pausen machen, sind fokussierter, treffen bessere Entscheidungen und sind kreativer. Die Viertagewoche, die in mehreren Pilotprojekten weltweit getestet wurde, zeigt eindrucksvoll: Weniger Zeit kann mehr Leistung bringen – wenn die Zeit sinnvoll genutzt wird und das unternehmerische Setting auch wirklich stimmt.
Doch stattdessen zwingen wir Menschen dazu, acht Stunden lang ‘produktiv’ zu wirken. Sie klicken sich durch irrelevante Mails, schreiben Kommentare in Chatgruppen, buchen Meetings ohne Agenda – nur um präsent zu sein. Die Angst, als faul und träge zu gelten, wiegt schwerer als der Mut zur Ehrlichkeit. So wird die Arbeitszeit zur Farce, zur Simulation. Eine teure, ineffiziente – und zutiefst unproduktive – Angelegenheit.
Die Gen Z als Vorhut – unbequem, aber ehrlich
Die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt, oft als Gen Z bezeichnet, hat die Pandemie als prägende Phase ihrer Arbeitssozialisation erlebt. Sie kennt den Output-orientierten Homeoffice-Stil, sie hat erlebt, dass Vertrauen bessere Ergebnisse liefert als Kontrolle. Kein Wunder also, dass diese Generation die Präsenzpflicht als unnötiger Rückschritt erlebt. Ihre Reaktion: Keine offene Revolte – sondern raffinierte Selbstbehauptung. Taskmasking ist für sie keine Faulheit, sondern Selbstschutz. Und ein stiller Hinweis: So funktioniert es für uns nicht mehr.
Während ältere Generationen sich oft noch mit Loyalität und Durchhalteparolen identifizieren, sucht die Gen Z nach Sinn, Balance und Autonomie. Und sie hat keine Scheu, diese Ansprüche auch einzufordern. Vielleicht ist sie unbequem – aber sie ist ehrlich. Und das macht sie somit zur wichtigsten Reformkraft der modernen Arbeitswelt.
Generationenübergreifend: Wer ohne Maske ist, werfe den ersten Stein
Die Wahrheit ist: Nicht nur die Jungen maskieren. Auch Generation X und die Babyboomer haben in der Zwischenzeit ebenso längst Wege gefunden, um offensive Präsenz zu simulieren. Der Unterschied liegt im Stil: Während die Jungen mit offenen Tabs und TikTok jonglieren, perfektionieren Ältere das passive Meeting – stumm, aber sichtbar. Oder sie schreiben seitenlange Berichte, die nie gelesen werden, nur um zu beweisen: ‘Seht her ich war fleissig.’ Das ist kein Vorwurf. Es ist ein Spiegel der Zeit.
Taskmasking ist nicht das Vergehen einzelner – sondern ein kollektiver Reflex auf ein ausgehöhltes Arbeitsethos.
Der neue Imperativ: Vertrauen statt Theater, Wirkung statt Geste
Statt immer neue Systeme zur Erfassung von Zeit, Präsenz und Aktivität zu entwickeln, sollten Unternehmen beginnen, anders zu führen. Vertrauen schaffen. Klar kommunizieren, was wirklich zählt. Auf Wirkung schauen, nicht auf Gesten. Wenn wir den Menschen ihre Selbstverantwortung zurückgeben, wenn wir ihnen zutrauen, dass sie auch ohne Überwachung gute Arbeit leisten – dann braucht es kein Taskmasking mehr. Dann wird aus Theater wieder echte Arbeit mit spannenden Drehbüchern und sinnstiftender Regie. Sinnvoll, produktiv – und vielleicht sogar erfüllend.